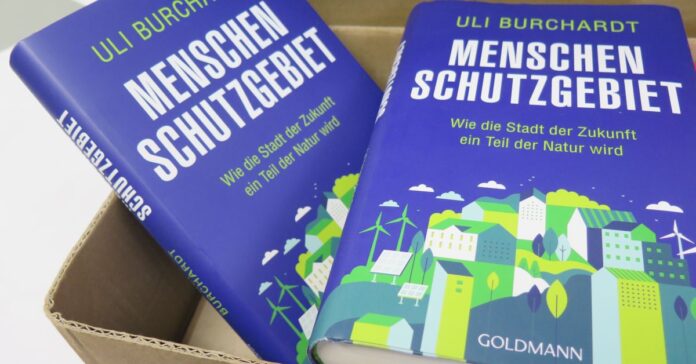„Die Stadt Konstanz mit ihrem Oberbürgermeister Uli Burchardt ein politischer Prototyp für Baden-Württemberg und die Republik? Ich hoffe es.“ Diese Zeilen schrieb die einstige Politikgröße Heiner Geißler am 10. Juli 2013 bei seinem Besuch in Konstanz ins Goldene Buch der Stadt. Aber was zeichnet den Prototyp, von dem der 2017 verstorbene ehemalige Bundesminister Geißler so sehr schwärmte, aus? Über seine Vorstellung der Stadt von morgen hat Burchardt nun ein Buch geschrieben. „Menschenschutzgebiet. Wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird“ heißt der jüngst im Goldmann-Verlag erschienene Band. Darin fächert der Oberbürgermeister sein zukunftsgewandtes Verständnis von Politik, Stadt und Natur auf.
Die Stadt als Menschenschutzgebiet
Seine zentrale These: „Die Stadt ist auch nur ein Ökosystem.“ Burchardt vergleicht den Menschen mit dem Biber. „So, wie der Biber sich seinen Lebensraum auf Kosten anderer Arten gestaltet, so gestaltet sich der Mensch seinen“ – und zwar hier, in der Stadt. Insofern ist Urbanität niemals Gegenspieler, sondern Teil der Natur. Mit diesem Gedanken setzt Burchardt in seinem Buch zwei Punkte.
Erstens: „Es braucht eine große gesellschaftliche Debatte darüber, was eigentlich Natur ist und was demzufolge Naturschutz ist und was nicht.“ Zu oft verhindere sektorales Denken – Naturschutz, Klimaschutz, Gewässerschutz, Artenschutz, Lärmschutz, Denkmalschutz, Brandschutz et cetera – pragmatische Lösungen für den menschlichen Lebensraum im Sinne des großen Ganzen. Es gelte, „vom destruktiven, ideologischen, verhindernden Naturschutz der Vergangenheit“ wegzukommen – „hin zum ganzheitlich gedachten, konstruktiv arbeitenden Naturschutz der Zukunft“, meint Burchardt. „Naturschutz muss Menschenschutz sein.“
Zweitens: „Für die Zukunft der Welt ist die Stadt das entscheidende Ökosystem“, schreibt der Oberbürgermeister in seinem Buch. „Kriegen wir es hin, dieses Ökosystem nachhaltig zu gestalten, dann haben wir den wesentlichen Teil unserer ökologischen Herausforderungen der Gegenwart gemeistert.“ Sein Fazit: „Es braucht zusammengefasst die klimaneutrale, digitale, nachhaltige, gemischte, diverse, gerechte, gut gemanagte Stadt der Zukunft, die niemanden zurücklässt und alle beteiligt.“

Die Stadt der Zukunft im Spiegel biografischer Noten
Doch wie sieht diese Stadt, dieses „Menschenschutzgebiet“, wie Burchardt sie nennt, denn nun aus? Für die breite politische Debatte liefert sein Buch einen gewinnbringenden Einblick in die kommunale Lebensrealität und in die Gedankenwelt eines Stadtmanagers. Es spiegelt zentrale urbane Zukunftsthemen wider und eröffnet Perspektiven auch im Sinne der umfassenden gesellschaftlichen Transformation hin zur Klimaneutralität. Diejenigen, die sich ohnehin intensiv mit Stadtentwicklung beschäftigen, finden darin allerdings wenig Überraschendes.
Gleichwohl sind die biographischen Noten, die das Buch enthält, durchaus unterhaltsam. Es ist eine Leseempfehlung für jeden Stadtlenker. Burchardt kommt ins Erzählen und beschreibt ansonsten sperrige Themen wie Agrarchemie, CO2-Messungen oder Waldbewirtschaftung launig und aus eigenem Erleben. So zeichnet sich seine Argumentation durch besondere Authentizität aus. Seine vernünftige Idee der Stadt als „Menschenschutzgebiet“ stammt aus der Praxis und kommt ideologiefrei daher. Doch dieser Ansatz hat auch zur Folge, dass der Autor bisweilen ausschweift – über die Weimarer Reichsverfassung bis hin zu Napoleon. Nicht, dass seine diesbezüglichen Ausführungen nichts mit dem Thema zu tun hätten. Doch der Bogen ist eben sehr weit.
Demgegenüber kommt gerade die pionierhafte Rolle, die Konstanz in der Debatte um Klimaschutz einnimmt, vergleichsweise kurz. 2019 hat die Stadt, getrieben von der Fridays-For-Future-Bewegung, als erste in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Das findet im Buch selbstverständlich eine Würdigung. Was aber nur ein kursiv gedrucktes Kapitel ist, hätte über die schemenhafte Darstellung hinaus doch das Zeug dazu gehabt, zum zentralen, gegenwartsbezogenen Leitmotiv des Buchs zu werden. Wo sonst gibt es Gelegenheit, über dieses historische Momentum Hintergründiges aus erster Hand zu erfahren?
Hochaktuell, aber wenig Neues
Natürlich schreibt Burchardt über die Verkehrswende und den Paradigmenwechsel weg von der autogerechten Stadt. Dabei darf der vielzitierte Ansatz des Stararchitekten Jan Gehl nicht fehlen, der Mensch müsse in der Stadtplanung das Maß der Dinge sein. Natürlich beschreibt er die Ideen der Kreislaufwirtschaft und des Sharings, der gemeinsamen Nutzung von – auch räumlichen – Ressourcen, als leitend für die Stadt von morgen. Natürlich bezieht er sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Agenda 2030, sowie die 2020 verabschiedete Neue Leipzig-Charta als europäischen Kompass für eine grüne, produktive und gerechte Stadt. Dabei fällt seine Vorstellung von einer sich neu ausrichtenden und an Relevanz gewinnenden urbanen Landwirtschaft besonders auf.
Das alles ist hochaktuell. Aber es birgt in Summe eben wenig Neues. Welche Effekte hat etwa das immer greifbarer werdende autonome Fahren auf die Stadtplanung? Ergibt sich daraus die Möglichkeit, Verkehre zu bündeln und so mehr Platz für Grün und den Menschen in der Stadt zu schaffen? Wie können Drohnen den Logistikverkehr entlasten, wie es mancherorts bereits erprobt wird? Können Flugtaxis unter Nachhaltigkeitskriterien eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV sein? Und welche Rolle nimmt das sogenannte Carbon Farming, das Fixieren von CO2, in der Stadt im Kampf gegen den Klimawandel ein? Würde die titelgebende Frage, „wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird“, nicht explizit in die Zukunft weisen, würde man Antworten auf Fragen wie diese in Burchardts Argumentation vielleicht gar nicht sonderlich vermissen. Doch so bleibt irgendwie etwas offen.
Prototyp Burchardt macht Lust auf Transformation
Derweil ist Burchardts Neugier auf urbane Transformation begeisternd und inspirierend. Sein optimistischer Grundtenor in der Beschreibung und sein kategorisches „Kein Zurück zu irgendwas“ machen – entgegen der mancherorts zu hörenden Klimanotstandsendzeitstimmung – Lust darauf, den Wandel mitzugestalten. In diesem Sinn bleibt der Wunsch Geißlers haften, dass mehr politische Entscheider dem Prototyp Burchardt folgen.
Andreas Erb ist Redakteur im Public Sector des F.A.Z.-Fachverlags. Für die Plattform #stadtvonmorgen berichtet er über urbane Transformationsprozesse, die Stadtgesellschaft und die internationale Perspektive der Stadt. Seit 1998 ist der Kulturwissenschaftler als Journalist und Autor in verschiedenen Funktionen tätig, seit 2017 als Redakteur im F.A.Z.-Fachverlag.